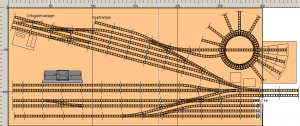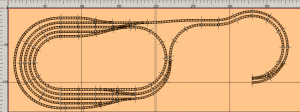Digital and Elektrik echoray on 11 Apr. 2010
Umstellung auf Tams MasterControl
Wenn die Weichen nicht zuverlässig umschalten, ist kein geordneter Modellbahnbetrieb möglich. Dieses Problem konnte ich noch umschiffen. Nicht weniger lästig waren aber ständige Abschaltungen wegen angeblicher Überlast der Roco-Booster, die auftraten, nachdem das elektrische Netz der Anlage bereits eine stattliche Größe erreicht hatte.
Unter diesem Problem hatte bereits die Dortmunder Anlage gelitten. Ich hatte das damals auf Schlampereien bei der Verkabelung geschoben, mir geschworen, dass in Meschede alles besser wird und versucht, mir mehr Mühe zu geben. Es hat aber nichts genutzt. Ich weiß nicht, woran es wirklich lag. Ich tippe mal auf Ausgleichsströme über die gemeinsame Masseleitung der Anlage, bzw. Probleme durch ein Sammelsurium verschiedener Trafotypen.
Ich habe die betroffenen Stromkreise mal durchgemessen. Ein Roco-Booster sollte planmäßig bei etwa 3 Ampere Last abschalten. Auf meiner Anlage war teilweise bei 0,6 A Ende im Gelände. Die Roco-Booster liefern keine stabilisierte Ausgangsspannung. Irgendwo da dürfte der Hase begraben gelegen haben. Der Booster sieht einen Spannungsabfall, hält dies für einen Kurzschluss und macht dicht.
In meiner Not habe ich daher die Roco-Booster ausgemustert und durch spannungsstabilisierende Booster B-4 von Tams ersetzt, zusammen mit einer neuen Digitalzentrale Tams MasterControl. Gleichzeitig habe ich alle Licht- und Bahnstromtrafos einheitlich durch von Tams gelieferte Trafos ersetzt. Das war der große Wurf. Versuchsweise habe ich die einstmals drei Boosterkreise meiner Anlage zu einem Kreis zusammengeschaltet. Mit den Roco-Boostern ging das nicht. Ein Tams-Booster reicht aus, um die Anlage komplett zu versorgen, mit der Roco überfordert ist.
Auf die Tams-Zentrale umzustellen, war eine sehr gute Entscheidung. Damit haben sich auch die kleinen Software-Niggeligkeiten der Multimaus erledigt (z.B. nicht anfahrende Züge). Nach der Umstellung muss man allerdings alle Weichen- und Signaladressen in Traincontroller um 4 nach unten korrigieren. Wie man hört gibt es an dieser Stelle Differenzen um die buchstabengetreue Auslegung des DCC-Standards zwischen Roco (die haben wohl richtig gelesen) und Uhlenbrock (an letzteren orientiert sich die Tams MC).
Einen Roco-Booster habe ich behalten. Ihm bleibt die vornehme Aufgabe, das Programmiergleis zu betreiben, und das Interface 10785 zu versorgen, wo weiterhin die Roco-Rückmelder angeschlossen sind. Versuchsweise habe ich ein Littfinski s88-Modul an die MC angeschlossen. Aus irgendeinem Grund wurde Traincontroller in den Versionen D2 und auch E1 in dieser Konfiguration bei meiner Anlagendatei extrem träge. Keine Ahnung woran das liegt. Ich werde jedenfalls den s88-Bus nicht nutzen und weiter mit Roco rückmelden.